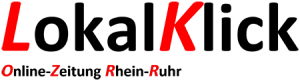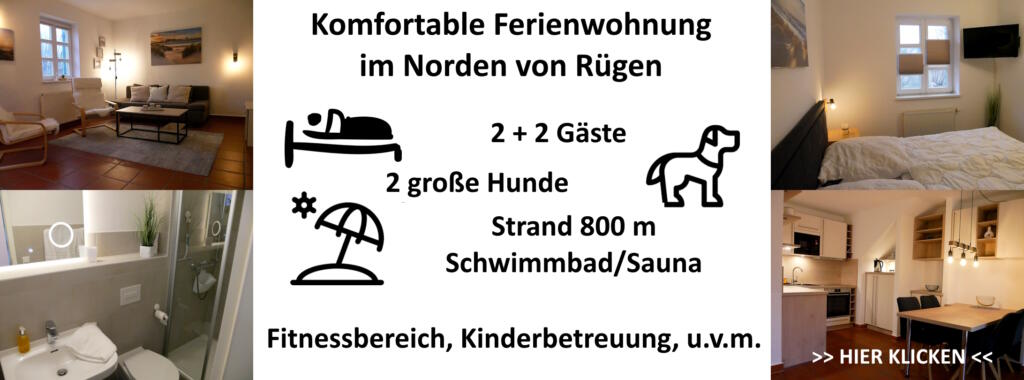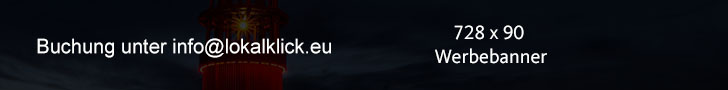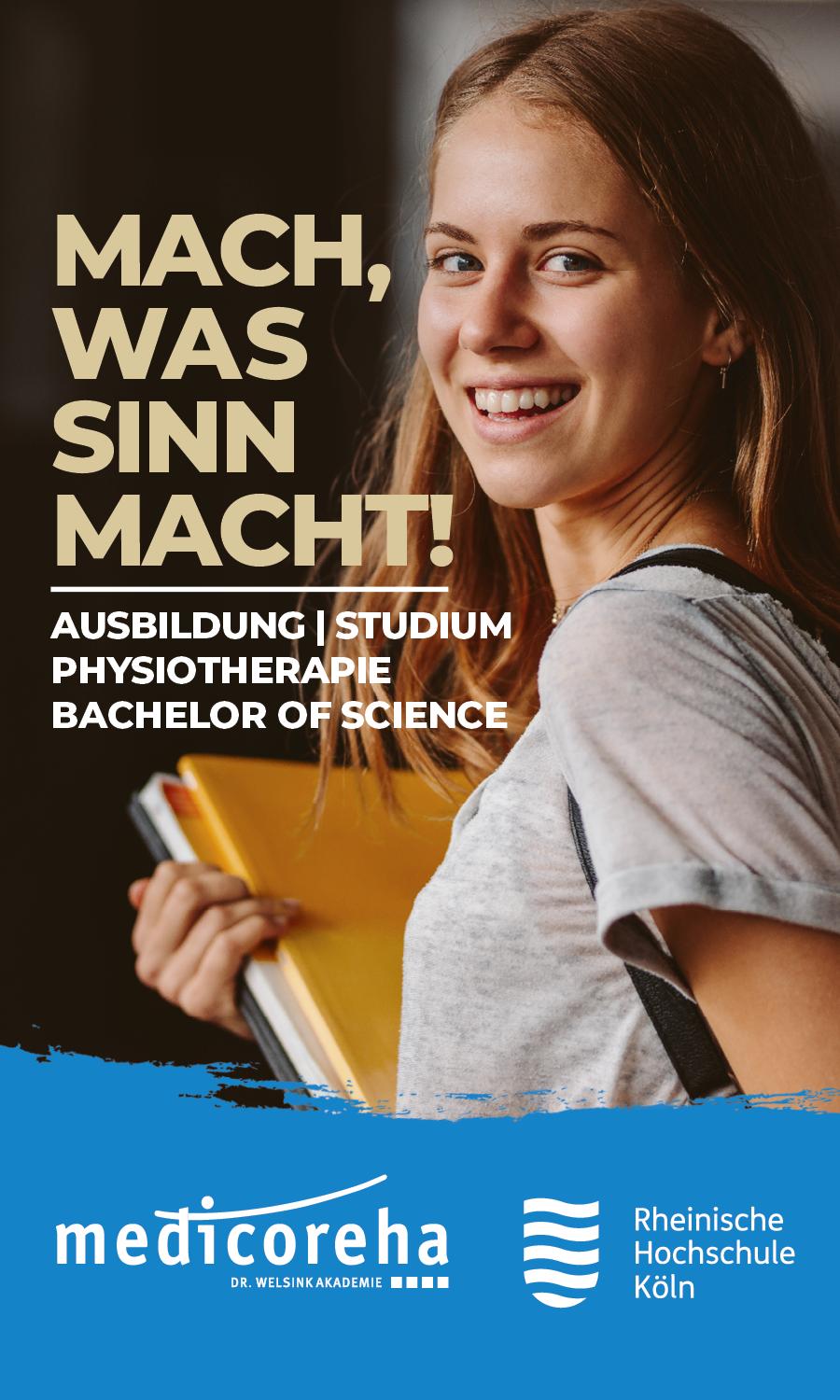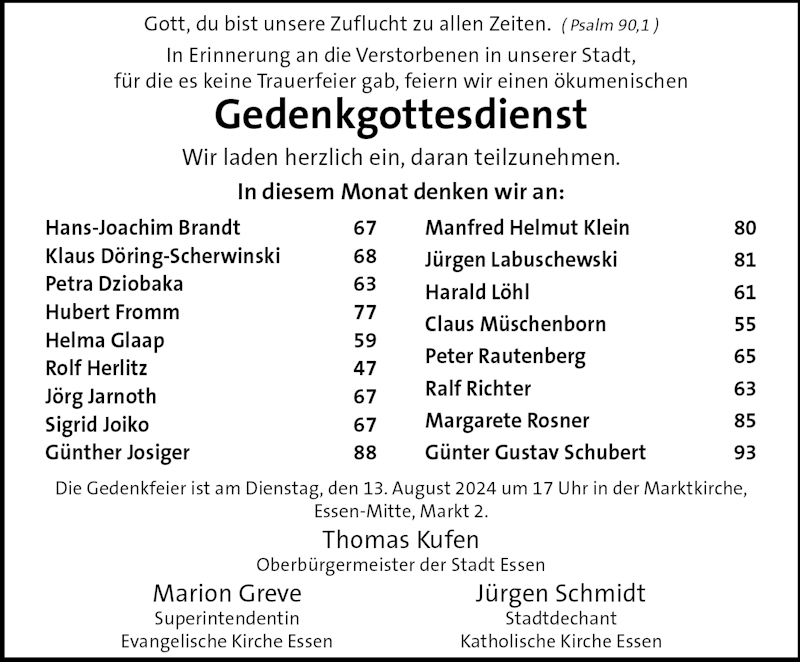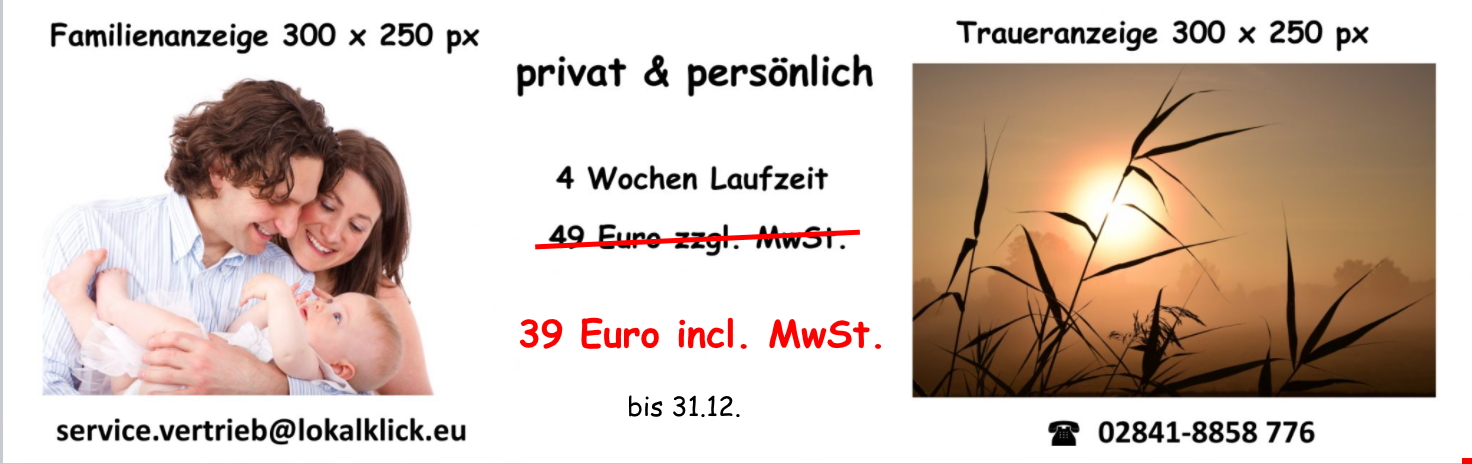Oberhausen. Es ist eine kleine Sensation: In einer ehemaligen Synagoge im Oberhausener Stadtteil Holten, die Jahrzehnte lang als Wohnhaus genutzt worden war, haben von der Stadt Oberhausen beauftragte Fachleute für Baugeschichte und Restaurationen bedeutende Relikte gefunden. Dazu gehören eine Mikwe, also ein jüdisches Ritualbad, aber auch Schriftzüge an den Wänden und die Nische für den Toraschrein. Die Funde in der ehemaligen Synagoge seien „bundesweit von großem Seltenheitswert“, stellt ein Gutachten des zuständigen LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland fest.
Wie diese bedeutenden Funde in Zukunft präsentiert und die ehemalige Synagoge Oberhausen-Holten nach einer Sanierung genutzt werden könnte, dazu hat das renommierte Stuttgarter Atelier Brückner im Auftrag der Stadt Oberhausen ein Konzept erarbeitet. Oberbürgermeister Daniel Schranz und Expertinnen und Experten des Ateliers Brückner und der Stadtverwaltung stellten es am Freitag, 24. Mai 2024, erstmals der Öffentlichkeit vor. Es geht nun in den kommunalpolitischen Gremienlauf und kann in der Sitzung am 1. Juli 2024 vom Rat der Stadt Oberhausen beschlossen werden.
Oberbürgermeister Schranz: Funde in ehemaliger Synagoge als große Chance
„Die ehemalige Synagoge in Holten ist das letzte noch existierende Zeugnis jüdischen Lebens in Oberhausen von vor der Herrschaft der Nationalsozialisten. Dieser historische Schatz bringt große Verantwortung und ebenso große Chancen mit sich“, sagt Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz: „Das hervorragende, vom Atelier Brückner erarbeitete Konzept trägt der Verantwortung Rechnung und greift die Chancen auf.“
Dem Konzept zufolge soll das Gebäude behutsam so restauriert werden, dass nicht nur die Relikte der Nutzung als Synagoge gesichert werden, sondern auch die Nutzung als Wohngebäude in Schemen erkennbar bleibt. Das hat einen guten Grund: „Gerade die Tatsache, dass die ehemalige Synagoge bereits vor dem 9. November 1938 in ein Wohnhaus umgewandelt worden war, hat diese Funde erst ermöglicht“, erklärt Schranz, selbst studierter Historiker: „Wäre sie zu dem Zeitpunkt noch als jüdisches Gotteshaus genutzt worden, wäre sie in der Reichspogromnacht sicher genauso von den Nationalsozialisten zerstört worden wie die Synagoge an der Oberhausener Friedensstraße und Hunderte andere in Deutschland.“ Laut Gutachten des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) gab es um 1900 im Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen 337 Synagogen, davon sind nur 71 erhalten.
Ehemalige Synagoge als Ort für Erinnerung, Bildung und Integration
Für die Nutzung des Gebäudes nach der Restaurierung sieht das Konzept des Ateliers Brückner drei Säulen vor: erstens die Nutzung als Erinnerungs- und Gedenkort für jüdische Geschichte. Als zweite Nutzung ist ein Ort der Beschäftigung mit Themen wie Flucht, Vertreibung und Migration denkbar, die sich einerseits aus den Biografien der früheren jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner Holtens und Oberhausens ergeben, aber eben auch zur Geschichte vieler Oberhausenerinnen und Oberhausener heute gehören. Als dritte Säule könnte das Gebäude als ein Raum sozialer Integration dienen. „So würde die restaurierte ehemalige Synagoge die Oberhausener Gedenkkultur um einen herausragenden und nicht nur für unsere Stadt relevanten Erinnerungs- und Bildungsort erweitern“, sagt Schranz: „Sie ist in besonderem Maß geeignet, die Themen der Vergangenheit mit Fragen der Gegenwart und der Zukunft zu verbinden.“
Geschichte der Synagoge Oberhausen-Holten
Die ehemalige Synagoge in Oberhausen-Holten wurde 1858 von der jüdischen Gemeinde in dem Ort als eingeschossiges Gebäude mit Satteldach und neugotischen Zierformen erbaut. Bis mindestens 1927 wurde das Gebäude als Synagoge genutzt und 1936, also vor der Reichspogromnacht 1938, in ein Wohnhaus umgebaut. Als solches wurde es bis in die 2010er Jahre genutzt. Trotz der vielen Veränderungen wurde der Bau 1991 in die Denkmalliste eingetragen. 2019 erwarb die Stadt Oberhausen die ehemalige Synagoge, um die historische Bedeutung des Ortes dauerhaft sichern zu können.
Wie viele Gestaltungselemente noch aus der Zeit der Nutzung als Synagoge erhalten sind, hat erst die bauhistorische Untersuchung und der behutsame Rückbau der Einbauten im Inneren ergeben. „Es gibt in Deutschland nur wenige Synagogen aus der Zeit vor 1933, in denen – trotz aller Verluste und Veränderungen, die in der Holtener Synagoge zu beklagen sind – vergleichbar viele Ausstattungselemente und Details erhalten sind“, betont das Gutachten des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland.
Konzept für Gestaltung und Nutzung stammt vom Atelier Brückner
Den Entwurf des Gestaltungs- und Nutzungskonzeptes für die Synagoge Oberhausen-Holten hat das renommierte Stuttgarter Atelier Brückner entwickelt. Das Atelier zählt mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den weltweit führenden Büros für Ausstellungen, Architektur und Szenografie. Seit 1997 entwickeln die Stuttgarter Experience Designer national und international narrative Räume für Museen, Marken- und Besucherzentren.
Im Bereich der Architektur liegt ein Schwerpunkt des Ateliers Brückner in der Revitalisierung und Umnutzung von Industriearealen zu Kulturstätten und ähnlichen Nutzungen. Projekte wie die Wagenhallen in Stuttgart, das Textilwerk Bocholt oder das BMW Museum in München sind Beispiele für die Sanierung, technische Ertüchtigung und Erweiterung. Durch den ganzheitlichen Ansatz entstehen Projekte, die eine Synthese von Architektur und Inhalt darstellen und als markante Zeichen im Stadtbild erkennbar sind.
Hintergrund ehemalige Synagoge und jüdische Geschichte in Oberhausen-Holten
(nach Stein, Claudia, Elm, Monika: Verlorene Heimat. Die jüdische Gemeinde Holten 1504 – 1941, Oberhausen, Verlag Karl Maria Laufen, 2022)
- Bereits im frühen 16. Jahrhundert waren Jüdinnen und Juden in Holten ansässig.
- Bis zur Mitte des 19. Jahrhundert fehlte der jüdischen Gemeinde ein eigenes Gotteshaus.
- 1846 lebten sechs jüdische Familien in Holten (Metzger Andreas Isaac, Herz Aron, Daniel Heymann, Daniel Anschel, Händler Isaac Wolf und Hermann Gottschalk).
- Bis 1855 wuchs die Gemeinde auf 31 Personen; jüdische und christliche Bürgerinnen und Bürger lebten in guter Nachbarschaft.
- 1856 erwarben Herz Aron, Israel Gumpertz, Josef Gumpertz, Alexander Heymann, Jacob Isaac, Isaac Wolf und Daniel Daniel aus dem benachbarten Sterkrade für den Synagogenneubau ein Grundstück an der heutigen Mechthildisstraße. Nachdem das dortige Bestandsgebäude abgerissen worden war, konnte mit dem Neubau begonnen werden. Das Gebäude ist nicht, wie nach jüdischem Gesetz vorgeschrieben, nach Jerusalem ausgerichtet. Die Baukosten beliefen sich auf 1800 Mark. Am 23. Juli 1858 wurde die Synagoge feierlich eröffnet.
- Ab Mitte der 1920er Jahre wurde das Gebäude von der schrumpfenden jüdischen Gemeinde Holtens nicht mehr als Synagoge genutzt; als die Mindestzahl von zehn männlichen religionsmündigen Gemeindemitgliedern nicht mehr erreicht wurde, wurde die Synagoge geschlossen und die Ausstattung (Gebetbücher, Ritualgegenstände und Mobiliar) nach Duisburg-Hamborn gebracht.
- Die Gemeinde verpachtete das Gebäude; der damalige Mieter baute das Erdgeschoss ab Ende 1936 zum Wohnen um und aus, u.a. mit neuen Fensteröffnungen, Deckenbalken, Wasserleitungen, einem Kamin und Zementestrich.
- Zwangsverkauf 1938: Julius Wolf verkaufte das Grundstück und das Gebäude in Vertretung seines Vaters Simon Wolf, der zu diesem Zeitpunkt Alleininhaber war, (weit unter Wert) für 3300 Mark an den Schlosser Bernhard Heisterkamp.
- Durch die Wohnnutzung und die geänderten Eigentumsverhältnisse wurde das Gebäude von der Zerstörungswelle der Reichspogromnacht verschont. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurde es partiell beschädigt (u.a. Fenster, Dach). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Obergeschoss eine weitere Wohnung eingebaut. LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland: „Trotz vielfältiger Veränderungen sind zahlreiche Details erhalten, die einen seltenen Eindruck ländlicher Synagogenbauten in der Mitte des 19. Jahrhunderts vermitteln.“
- Julius Wolf musste kurze Zeit nach dem Verkauf der ehemaligen Synagoge mit seiner Familie nach Köln-Braunsfeld umziehen, wo er eine Stelle als Hausmeister in einem jüdischen Waisenhaus annahm. 1942 wurde die Familie ins Vernichtungslager nach Trostenez bei Minsk deportiert, wo sie nur vier Tage später ermordet wurde. Julius Wolfs Eltern Simon und Johanna Wolf zogen 1939 in ein Altenheim nach Köln, wo Simon Wolf im Juli 1939 starb.
- Die Jewish Trust Corporation for Germany mit Sitz in Mülheim an der Ruhr stellte 1950 in Vertretung für den Geschädigten und 1939 verstorbenen Simon Wolf einen Antrag auf Rückerstattung des Vermögens bzw. des Grundstücks gegen Bernhard Heisterkamp (und nach dessen Tod gegen die Erben), denn, so der Vorwurf der Antragstellerin, die ehemalige Synagoge war unter Nötigung deutlich unter Wert verkauft worden. Das Verfahren beim Wiedergutmachungsamt zog sich über Jahre, da sich die neue Eigentümerfamilie weigerte, die Ansprüche des Geschädigten anzuerkennen. Erst nach sechs Jahren konnte die Rückerstattungssache mit einem Vergleich abgeschlossen werden. Darin verpflichtete sich die Eigentümerfamilie zu einer Zahlung von 2400 DM an die Jewish Trust Corporation for Germany.
- Bis in die 2010er Jahre hinein wurde die ehemalige Synagoge als Wohnhaus genutzt.
- 1991 wurde das Gebäude in die Denkmalliste eingetragen.
- Die Stadt Oberhausen kaufte die ehemalige Synagoge 2019.